Hamburger Frauenbiografien
Ihre Suche
- Strasse : Thüreyweg
- A-Z Register : Anfangsbuchstabe T (Name)
Magda Thürey
( Magda Thürey, geb. Bär )
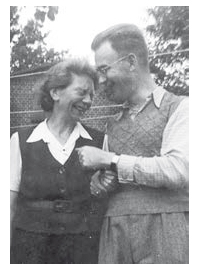 Magda und Richard Thürey, Bildquelle: Gedenkstätte Ernst Thälmann
Magda und Richard Thürey, Bildquelle: Gedenkstätte Ernst Thälmann
Von 1914 bis 1919 besuchte Magda Thürey das Lehrerseminar Hohe Weide im Stadtteil Eimsbüttel. Auch war sie künstlerisch interessiert und schloss sich in der Studienzeit bohemearigen Kreisen junger Menschen mit kommunistischen Ideen an. Außerdem arbeitete sie in der Wandervogelbewegung und der Freideutschen Jugend mit. Anfang der 20er Jahre trat Magda Thürey in die KPD ein und war kurz vor 1933 zeitweilig für ihre Partei in der Hamburgischen Bürgerschaft als Spezialistin für Schulfragen tätig.
In den Jahren 1919 bis 1933 unterrichtete sie Volksschulklassen an den Schulen Lutterothstraße Nr. 80 und Methfesselstraße Nr. 28 (ab 1930) im Hamburger Arbeiterstadtteil Eimsbüttel. Sie nahm ihre Arbeit sehr ernst, orientierte sich an den Erziehungsidealen Pestalozzis und kümmerte sich gerade um die ärmsten Kinder. Außerdem trat sie der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens bei, heute: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).
1933 wurde sie von den Nationalsozialisten sofort ohne jeglichen finanziellen Ausgleich aus dem Schuldienst entlassen. Als Begründung diente den "Machthabern" das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" dessen Pharagraph 2 eine Mitgliedschaft in der KPD verbot.
Magda Bär heiratete ihren langjährigen Freund Paul Thürey, der zu dieser Zeit bereits arbeitslos war, so dass die Eheleute nun, um sich eine Existenz aufzubauen von ihren Ersparnissen ein Seifengeschäft in der Osterstraße im Stadtteil Eimsbüttel kauften, welches sie später in die Eimsbüttler Emilienstraße Nr. 30 verlegten.
1939 fand Paul Thürey Arbeit in den Conz-Elektromotoren-Werken, einem Rüstungsbetrieb. Magda führte den Laden allein weiter.
Der Seifenladen war von vornherein nicht nur als Erwerbsquelle gedacht gewesen, sondern diente gleichzeitig als Treffpunkt für die illegale KPD. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges fungierte der Laden insbesondere als wichtige Verbindungsstelle für die kommunistische Bästlein-Jacob-Abshagen Widerstandsgruppe - in Seifenkartons wurden Flugblätter und illegale Druckschriften versteckt; es fanden Treffs statt, Informationen wurden ausgetauscht und neue Aktionen geplant.
1942 nahm die Hamburger Gestapo Paul Thürey fest. 1944 wurde er bei den Hamburger Kommunistenprozessen zum Tode verurteilt und am 26. Juni 1944, im Alter von 41 Jahren, im Hamburger Untersuchungsgefängnis enthauptet. Die 44jährige Magda Thürey war von der Gestapo am 30.10.1943 in "Schutzhaft" genommen und ins Gefängnis Fuhlsbüttel gebracht, der Seifenladen von der Gestapo zu einer Falle umfunktioniert worden, so dass es zu weiteren Verhaftungen kommunistischer Widerstandskämpfer und -kämpferinnen kam.
Durch die Haftbedingungen verschlechterte sich Magda Thüreys Gesundheitszustand rapide - sie litt seit ihrem 31sten Lebensjahr an multipler Sklerose. Aber erst als sie fast völlig bewegungslos war, wurde sie 1944 in das Krankenhaus Langenhorn auf die Station für Nervenkranke verlegt. Auch dort erhielt sie nicht die notwendige medizinische Versorgung. Magda Thüreys Bruder, ein Lehrer, der ebenfalls 1933 durch die Nazis aus dem Schuldienst entlassen worden war, konnte sie erst 1945 nach der Kapitulation Nazideutschlands, aus der Gefangenschaft nach Hause holen.
Am 17. Juli 1945 starb Magda im Alter von 46 Jahren an den Folgen der Gestapo-Haft. Ihr Begräbnis wurde die erste und einzige große Einheitskundgebung der linken Arbeiterparteien in Hamburg. Über ihrem Grab reichten sich die Vertreter von SPD (Karl Meitmann) und KPD (Fiete Dettmann) symbolisch die Hände und versprachen: "den Bruderkampf niemals wieder aufleben zu lassen."
Seit 1982 gibt es in Hamburg Niendorf den Thüreyweg, benannt nach Paul und Magda Thürey.
Text: Ingo Böhle
Quellen:
Vgl.: Gedenken heißt nicht schweigen. 11 neue Straßen in Niendorf zu Ehren von Frauen und Männern des Widerstandes. Schüler des Gymnasiums Ohmoor informieren. Gymnasium Ohmoor 1984.
Vgl.: Edith Burgard: Magda Thürey. "... und lehren, den Krieg zu verabscheuen". In: Ursel Hochmuth, Hans-Peter de Lorent (Hrsg.): Hamburg. Schule unterm Hakenkreuz. Hamburg 1985.
Vgl.: Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Frankfurt a. M. 1969.
Im Kurt-Schill-Weg steht ein Mahnmal: ein Tisch mit 12 Stühlen, 1987 geschaffen von dem Düsseldorfer Künstler Thomas Schütte zum Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Rückenlehnen sind mit Namen von Hamburger Widerstandskämpferinnen und -kämpfern versehen, hier auch der Name Magda Thürey.
Vgl.: Gedenken heißt nicht schweigen. 11 neue Straßen in Niendorf zu Ehren von Frauen und Männern des Widerstandes. Schüler des Gymnasiums Ohmoor informieren. Gymnasium Ohmoor 1984.
Vgl.: Edith Burgard: Magda Thürey. "... und lehren, den Krieg zu verabscheuen". In: Ursel Hochmuth, Hans-Peter de Lorent (Hrsg.): Hamburg. Schule unterm Hakenkreuz. Hamburg 1985.
Vgl.: Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Frankfurt a. M. 1969.
Im Kurt-Schill-Weg steht ein Mahnmal: ein Tisch mit 12 Stühlen, 1987 geschaffen von dem Düsseldorfer Künstler Thomas Schütte zum Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Rückenlehnen sind mit Namen von Hamburger Widerstandskämpferinnen und -kämpfern versehen, hier auch der Name Magda Thürey.
